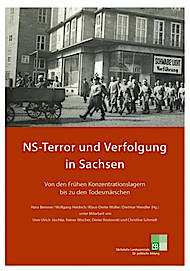- Aktuelles
- Wir
- Spurensuche
- Zeitzeugen
- Gedenktage - Zur Erinnerung und Mahnung
- Lidice
- Gedenk- und Bildgungsstätte Kassberg
- Unvergessen - Eine Rubrik zur Erinnerung und Mahnung
- Kriegsspuren in Chemnitz
- Stolpersteine - Mahnen auch in Chemnitz
- Ausstellungen, die die VVN BdA Chemnitz begleitet hat
- Kriegsendphasenverbrechen der Nazis - Eine Periode die nicht vergessen werden soll
- Stadtrundgang - "Auf den Spuren des antifaschistischen Widerstands in und um Chemnitz"
- Sachsenburg
- Friedhöfe
- Straßenumbenennungen - Erfassung aller nach 1990 erfolgten Umbennenungen von Straßen, Plätzen und Gebäuden in Chemnitz und Umgebung
- Kontakt
- Impressum
Folgen Sie uns:
Suche
Suche
Unvergessen - Otto Schmerbach


Otto Schmerbach wurde am 5. Januar 1904 in Eschwege geboren und am 21. April 1945 von den Faschisten erschossen.
Das Lernen fiel im leicht und mit Liebe und Fleiß erlernte er Russisch, Englisch und Französisch. Als junges Mitglied der KPD vervollständigte er seine Sprachkenntnisse und wurde Journalist.
1930 kam er nach Olbernhau, um für die "Rote Welle", die Ortszeitung der KPD für Olbernhau und Umgebung zu arbeiten. Gleichzeitig hatte er die Funktion des Bezirksleiters seiner Partei für das Osterzgebirge inne. Unter seinen Genossinnen und Genossen hatte er ein hohes Ansehen.
Die Faschisten nahmen in 1933 sofort in Haft und brachten ihn ins KZ Sachsenburg.
Nach Kriegsbeginn wurde er sehr oft als Dolmetscher für die Kriegsgefangenenlager eingesetzt, so z. Bsp. im Jahre 1940 im Lager Hartmannsdorf. Später verboten ihm die Faschisten das Betreten der Lager, denn er hatte zu "gute Beziehungen" aufgenommen und gepflegt.
Das wahre Kämpferherz Otto Schmerbachs wurde jedoch noch ersichtlicher in den Apriltagen 1945.
Das nahe Kriegsende zeichnete sich ab. Vom Osten her kamen die sowjetischen Truppen auf Chemnitz zu, während die amerikanischen Einheiten ihren Vormarsch stoppten und entlang der Linie Wüstenbrand-Autobahn-Röhrsdorf liegenblieben.
Den weiteren Beschuss der Stadt und vor allem die damit verbundenen menschlichen Verlust wollte Otto Schmerbach verhindern. Im Auftrag seiner Partei und der Einwohner von Siegmar-Schönau nahm er deshalb Verbindung zu den amerikanischen Truppen auf, um die Feuereinstellung zu erreichen und führte in Wüstenbrand die Übergabeverhandlungen.
Während sich der NS-Oberbürgermeister von Chemnitz aus Angst vor den Alliierten betrank, hisste Schmerbach weiße Fahnen.
Die Panzer der US-Armee zogen sich aber aus der Stadt zurück. Dies nutzten die Faschisten aus - die wieder in Siegmar eindrangen und verhafteten Otto Schmerbach. Dieser leistete Widerstand und wurde durch einen Schuss in den Oberarm verwundet. Von SS- und Wehrwolf-Einheiten wurde er am 21. April 1945 im Chemnitzer Zeisigwald erschossen.
Im zu Ehren wurde eine Straße benannt. Hier befand sich bis zu Beginn der 90-ziger Jahre der VEB Großdrehmaschinenbau "8. Mai" Karl-Marx-Stadt. Heute zum größten Teil ungenutzte Immobilie - Reststandort Niles-Simmens
Quellen/Literatur
Gedenkstätten, Arbeiterbewegung - Antifaschistischer Widerstand - Aufbau des Soziaismus, Urania-Verlag Leipzig Jena Berlin, 1974
Broschüre "Aus der Vergangenheit lernen, die Gegenwart meistern, die Zukunft gestalten", Rat der Stadt Karl-Marx-Stadt, Abt. Kultur
Broschüre "Gegen das Vergessen", VVN-BdA Stadtverband Chemnitz
NS-Terror und Verfolgung in Sachsen
Dr. Hans Brenner und seine 50 Mitstreiter haben ein umfangreiches Werk über die Anfänge der Konzentrationslager in Sachsen vorgelegt.
Die Neuerscheinung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wirft ein neues Licht auf die Zeit der Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 in Sachsen. Zu den Themen zählen das System der Frühen Konzentrationslager von 1933 bis 1937 (mit mindestens 80 sächsischen Städten und Gemeinden), die politischen Prozesse gegen Gegner des NS-Systems, Opferschicksale aus den verschiedenen Verfolgten-Gruppen und die als Todesmärsche bezeichneten Evakuierungsmärsche aus Konzentrationslagern und deren Außenlagern ab Herbst/Winter 1944 über sächsisches Territorium.
Mit einem umfangreichen Datenanhang und vier thematischen Karten liefert das Buch neuestes Forschungsmaterial für die sächsische Heimat- und Landesgeschichte.
Brenner, Hans / Heidrich, Wolfgang / Müller, KlausDieter / Wendler, Dietmar (Hrsg.) NS-Terror und Verfolgung in Sachsen.
Von den Frühen Konzentrationslagern bis zu den Todesmärschen Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Dresden 2018, 624 S