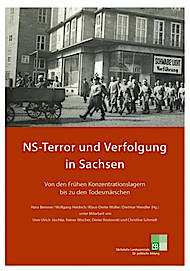- Aktuelles
- Wir
- Spurensuche
- Zeitzeugen
- Gedenktage - Zur Erinnerung und Mahnung
- Lidice
- Gedenk- und Bildgungsstätte Kassberg
- Unvergessen - Eine Rubrik zur Erinnerung und Mahnung
- Kriegsspuren in Chemnitz
- Stolpersteine - Mahnen auch in Chemnitz
- Ausstellungen, die die VVN BdA Chemnitz begleitet hat
- Kriegsendphasenverbrechen der Nazis - Eine Periode die nicht vergessen werden soll
- Stadtrundgang - "Auf den Spuren des antifaschistischen Widerstands in und um Chemnitz"
- Sachsenburg
- Friedhöfe
- Straßenumbenennungen - Erfassung aller nach 1990 erfolgten Umbennenungen von Straßen, Plätzen und Gebäuden in Chemnitz und Umgebung
- Kontakt
- Impressum
Folgen Sie uns:
Suche
Suche
Chemnitz -kurz vor Ende des Krieges
„Der Terror nahm in der Agonie des Systems wieder jene unverhüllten Züge an, die er in der
Frühzeit des Regimes besessen hatte. Er wurde offen und demonstrativ praktiziert. Sein
Wüten äußerte sich in den Erschießungen und den gefällten, barbarisch vollstreckten Todesurteilen
gegen die Verschwörer des 20. Juli 1944. Am 2. Januar 1945 war befohlen worden,
bei jedem Anzeichen einer umstürzlerischen Tätigkeit ‚sofort und brutal zuzuschlagen‘. Und
weiter. ‚Die Betreffenden sind zu vernichten.‘ Terroristen in den Uniformen der Wehrmacht,
der SS und von NS-Organisationen agierten in manchen Städten und Regionen bis in die
letzten Stunden vor dem Eintreffen von Truppen der Alliierten und organisierten wahre Massaker.
Sie entsprangen aus gezielten Aktionen ebenso wie aus blindwütiger, teuflischer
Mörderei.“
So charakterisiert Kurt Pätzold (3. Mai 1930 – 18. August 2016) in seinem Buch
„Gefolgschaft hinterm Hakenkreuz“, erschienen August 2017, verlag am park, die letzten
Tage des deutschen faschistischen Regimes. Das „Tausendjährige Reich“ war in
seiner Gesamtheit ein Verbrechen. Das Wüten der Faschisten während der letzten
Wochen und Tage des Zweiten Weltkrieges dürfte zweifellos nicht der Höhepunkt einer
Entwicklung gewesen sein; denn die Bilanz der faschistischen Herrschaft war längst
nicht erstellt. Aber es war die logische Folge der Blutrauschpropaganda führender
Nazis, es war die Folge zwölfjähriger Manipulation zum Wegschauen der Deutschen
bei Gräueltaten, begangen von Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die nicht einmal
versuchten, diese vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Alles, was vom „Führer“
ausging, waren Heldentaten. „Die obersten Führer riefen schließlich das Volk zum heldischen
Untergang à la Nibelungen. Goebbels malte am 28. Februar 1945 in einer Rundfunkansprache
das Bild, ‚dass auch von uns einst die Sage berichten kann, die Toten hätten nach
den Tagen der heißen Schlacht in den dunklen drohenden Nächten in den Lüften weitergekämpft’“,
zitiert Kurt Pätzold in seinem oben genannten Buch. Weiter kämpften allerdings
die Fanatisierten ihren sinnlosen Kampf, der viele genauso sinnlose Opfer kostete.
Chemnitz war von diesen Verbrechen nicht ausgenommen. Wie in vielen Regionen
Deutschlands dominierte in der Stadt die Rüstungsindustrie. Viele der sich im Osten
befindenden Werke waren nicht mehr in deutscher Hand. Hunderte Arbeiter und Angestellte,
vorher noch als „kriegswichtig“ vom Wehrdienst freigestellt, wurden in den
letzten Wochen noch zur Wehrmacht oder zum Volkssturm eingezogen. Diese Arbeitskräfte
fehlten, um den Glaube an den „Endsieg“, der durch die Nazi-Propaganda mit
Durchhalteparolen und Einschüchterungen suggeriert wurde, noch zu verwirklichen.
Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge aus den Außenlagern des KZ
Flössenbürg mussten in der Astra-Werke AG und Auto-Union AG Siegmar-Schönau (damals
selbständige Gemeinde) Sklavenarbeit leisten. Im Dezember 1944 und im April
1945 wurden diese evakuiert, weil Bombenabwürfe die Werke stark beschädigt hatten.
Der Krieg kam also zu seinen Wurzeln zurück. Viele deutsche Städte versanken in
Schutt und Asche. Vom 6. Februar bis zum 11. April 1945 rollten insgesamt zehn Luftangriffe
gegen Chemnitz. Aus 2881 Flugzeugen fielen 7716 Tonnen Sprengmittel und
Brandsätze. Zwischen 3600 und 4000 Menschen kamen ums Leben. Über 2100 davon
in der Nacht zum 6. März. Das waren aber nicht die einzigen Toten. Rund 8300 Angehörige
der Wehrmacht und der Waffen-SS starben während des Zweiten Weltkrieges bei
aktiven Kampfhandlungen. Insgesamt waren es über 12000 Kriegstoten. Das sind ca.
drei Prozent der Chemnitzer Vorkriegsbevölkerung. Zwar waren auch die Chemnitzer
durch die Bombenangriffe demoralisiert, für eine Beendigung des Krieges setzten sie
sich jedoch noch nicht aktiv ein. Dennoch verstärkte sich die Kriegsmüdigkeit auch bei
den Chemnitzern. In internen Tagesberichten vom 16. und 17. April an die Wehrmachtsführung
tauchten vermehrt Äußerungen des damaligen Kampfkommandanten, Generalmajor
Oskar Döpping, über Auflehnungen der Einwohnerschaft auf. Plünderungen auf
dem Güterbahnhof,das Hissen weißer Fahnen sowie die Beseitigung von Sperren gegen
die Alliierten sind darin vermerkt. Selbstverständlich wurden die Chmenitzer auch
dadurch zum „Widerstand“ in letzter Minute ermuntert, dass sich bereits US-Truppen
am Stadtrand befanden, wo sie jedoch bis zum Kriegsende verharrten. Döpping verweigerte
die kampflose Übergabe der Stadt. Zur Aufrechterhaltung dieser zweifelhaften
„Ordnung „ setzte er Polizei und Wehrmacht ein . Amerikanischer Artilleriebeschuß
war die Folge. Chemnitz war somit die letzte deutsche Großstadt, die von der Roten
Armee befreit wurde. (Quelle: Forschungsgruppe N S Geschichte, Archiv der VVN-BdA
Chemnitz)
Wochen vorher dürften großen Teilen der Bevölkerung auch die Todesmärsche durch
die Stadt nicht verborgen geblieben sein. Am 22. Februar 1945 durchquerten ca. 1000
jüdische Frauen von Grünberg und Schlesiersee (heute Polen) über Niederwiesa kommend
Chemnitz, um über Grüna nach Volary (heute Tschechien) zu gelangen. Unauffällig
waren auch weitere in diesem Heft beschriebene Todesmärsche nicht. So der mit 700
Häftlingen, die zu Fuß von Bunzlau über Chemnitz, Leipzig-Halle ins KZ Mittelbau Dora
getrieben wurden.
In die Erzählungen über Verbrechen während der Endphase des Zweiten Weltkrieges
und damit dem Ende der Herrschaft der deutschen Faschisten, reiht sich auch die der
Ermordung von sieben Nazigegnern am 27. März durch die Gestapo „Am Hutholz“ ein.
Rund 100 Antifaschisten waren vorwiegend im Gefängnis auf dem Chemnitzer Kaßberg
eingesperrt. Am 5. März 1945 wurde dieses Gefängnis durch Bomben stark in Mitleidenschaft
gezogen. Häftlinge nutzen die Gelegenheit, dieFlucht zu ergreifen. Chemnitzer
Häftlinge erhielten von Justizangestellten die Erlaubnis, zu Löscharbeiten nach Hause
gehen zu dürfen. Selbstverständlich mit der Verpflichtung, sich nach getaner Arbeit
wieder im Gefängnis zu melden. Wer sich melde, so logen die Beamten, gehe straffrei
aus. Der Kommunist Albert Hähnel glaubte diesem Versprechen und meldete sich tatsächlich zurück, was er mit dem Leben bezahlte. Nach der Reorganisation der Gestapodienststelle,
die Hand in Hand mit der Chemnitzer Polizei arbeitete, wurden viele
Geflüchtete abermals in Haft genommen. Der Gestapokommissar Wackerrow, verantwortlich
für „Hochverratsdelikte“, verfügte, dass von den 14 wieder gefassten Untersuchungshäftlingen
sieben „auszusondern“
seien. Es waren Max Brand, Albert
Hähnel,Albert Junghans, Walter Klippel,
Kurt Krusche, Alfons Pech und Willy
Reinl. Diese sieben Antifaschisten wurden
in eine Schule in Neukirchen bei
Chemnitz gebracht. Ein Sonderkommando
stand dort schon bereit. Zum
„Hutholz“ transportiert, mussten sie
eine vorhande Grube vertiefen. Als sie
mit dem Gesicht nach unten lagen, erschossen
die Faschisten die Untersuchungshäftlinge
mit Maschinenpistolen.
Fangschüsse sollten garantieren, dass die
Männer wirklich tot sind. Sie wurden
eilig verscharrt. Die Angehörigen erhielten
die Mitteilung: „Auf der Flucht erschossen“.
Das Grab am „Hutholz“ war
den Faschisten jedoch für die Vertuschung
ihrer Taten nicht sicher genug.
Zusammen mit anderen Leichnamen
transportierten sie die Sieben unter Hil-Denkmal am Hutholz
feihrer Handlanger, der DeutschenPost,
zum Krematorium in Werdau, wo man sie am 7. und 8. April einäscherte. Als einziger an
der Exekution Beteiligter wurde der Gestapo-Kommissar Erich Obst, da er in sowjetische
Kriegsgefangenschaft geriet, zu 25 Jahren Haft verurteilt. Komplett absitzen musste
auch er diese Strafe nicht. Alle anderen Mörder flohen in die sichere Westzone.
Heute erinnert ein Denkmal nahe der Chemnitzer Wolgograder Allee, geschaffen vom
Bildhauer Hanns Diettrich, an diese grausamen Morde. Nicht Jedem ist dieses Gedenken
recht. Dass dieses Denkmal bereits mehrfach geschändet wurde zeigt, wie fruchtbar
der Schoß des Faschismus heute noch ist.
Um Chemnitz machten die faschistischen Verbrecher am Ende des Krieges also keinen
Bogen. Auch hier glaubten, obwohl es weniger wurden, viele noch an einen „Führer“,
der einem Messias gleich, die Situation in letzter Minute wenden könnte. Dieser „religiöse“
Gedanke war der Bevölkerung 12 Jahre lang eingeimpft worden.
Kurt Pätzold dazu in „Gefolgschaft hinterm Hakenkreuz“: „Ein Teil der zusammenschmelzenden
Gefolgschaft klammerte sich an den Gedanken, dass es einen Ausweg gäbe, der nicht
bedingungslose Kapitulation hieß. Hitler galt, wenn auch nicht mehr als Garant eines glorreichen
Endes, so doch als Führer, der selbst aussichtslos erscheinende Situationen zu meistern
verstünde. Als die Hoffnung auf kriegswendende Wunderwaffen schon vollständig verflogen
war, lebte der Glaube an IHN in gewiss dahin schwindenden Resten noch fort. Hitler half
selbst, die Vorstellung von seiner absoluten Ausnahmestellung zu erhalten. In seiner Rundfunkansprache
am 30. Januar 1945 aus Anlass des 12. Jahrestages seiner ‚Machtergreifung‘
tischte auch er die Mär auf, der ‚Allmächtige‘ habe ihn am 20. Juli 1944 geschützt und werde
ihn auch jetzt und weiter nicht verlassen.“
NS-Terror und Verfolgung in Sachsen
Dr. Hans Brenner und seine 50 Mitstreiter haben ein umfangreiches Werk über die Anfänge der Konzentrationslager in Sachsen vorgelegt.
Die Neuerscheinung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wirft ein neues Licht auf die Zeit der Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 in Sachsen. Zu den Themen zählen das System der Frühen Konzentrationslager von 1933 bis 1937 (mit mindestens 80 sächsischen Städten und Gemeinden), die politischen Prozesse gegen Gegner des NS-Systems, Opferschicksale aus den verschiedenen Verfolgten-Gruppen und die als Todesmärsche bezeichneten Evakuierungsmärsche aus Konzentrationslagern und deren Außenlagern ab Herbst/Winter 1944 über sächsisches Territorium.
Mit einem umfangreichen Datenanhang und vier thematischen Karten liefert das Buch neuestes Forschungsmaterial für die sächsische Heimat- und Landesgeschichte.
Brenner, Hans / Heidrich, Wolfgang / Müller, KlausDieter / Wendler, Dietmar (Hrsg.) NS-Terror und Verfolgung in Sachsen.
Von den Frühen Konzentrationslagern bis zu den Todesmärschen Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Dresden 2018, 624 S
Von Leipzig über Waldheim nach Buchenwald vom Anarchosyndikalisten zum Kommunisten
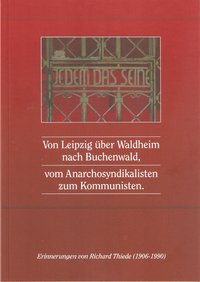
Erinnerungnen von Richard Thiede (1906 - 1990) Herausgegeben von Gert Thiede
Zu diesem Bericht Im Januar 1984, mit bereits 78 Jahren, hat mein Vater versucht, sein persönliches Leben schriftlich festzuhalten.
Sein Ziel war es, die Erinnerungen einmal in einer Schrift zusammenzufassen und der Öffentlichkeit oder einem Museum zur Verfügung zu stellen. Dabei kam es ihm vor allem darauf an, die in Zeiten politischer Engstirnigkeit mancher Funktionäre, ihre abwertende und abweisende Einschätzung zum Wirken der Freien-Arbeiterunion-Deutschlands (FAUD) in der Betrachtung der Arbeiterbewegung richtig zu stellen. ....