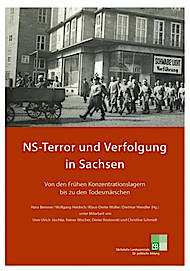- Aktuelles
- Wir
- Spurensuche
- Zeitzeugen
- Gedenktage - Zur Erinnerung und Mahnung
- Lidice
- Gedenk- und Bildgungsstätte Kassberg
- Unvergessen - Eine Rubrik zur Erinnerung und Mahnung
- Kriegsspuren in Chemnitz
- Stolpersteine - Mahnen auch in Chemnitz
- Ausstellungen, die die VVN BdA Chemnitz begleitet hat
- Kriegsendphasenverbrechen der Nazis - Eine Periode die nicht vergessen werden soll
- Stadtrundgang - "Auf den Spuren des antifaschistischen Widerstands in und um Chemnitz"
- Sachsenburg
- Friedhöfe
- Straßenumbenennungen - Erfassung aller nach 1990 erfolgten Umbennenungen von Straßen, Plätzen und Gebäuden in Chemnitz und Umgebung
- Kontakt
- Impressum
Folgen Sie uns:
Suche
Suche
Die Astra-Werke AG -Handlanger der Faschisten
Zwischen Oktober 1944 und April 1945 befand sich im Gelände der Astra-Werke AG,
Altchemnitzer Straße 41, ein Außenkommando des KZ Flossenbürg. 510 Frauen und
Mädchen, vor allem Russinnen, Polinnen und Italienerinnen, mussten hier Zwangsarbeit
für die deutsche Rüstungsindustrie leisten. Sie litten unter den Schikanen der SS-Aufseherinnen,
der schlechten Unterbringung und Verpflegung sowie den harten Arbeitsbedingungen.
Heute ist kaum noch vorstellbar, unter welchem seelischen Druck, welchen
Demütigungen und körperlichen Belastungen die weiblichen KZ-Häftlinge leiden
mussten.
Dem Betrieb wurdeindenAnkündigungslisten nur das Geschlecht, die Häftlingsnummer
und das Geburtsdatum der jeweiligen Person mitgeteilt -keine Namen.
Am 24. Oktober 1944 traf der Transport von weiblichen Häftlingen aus dem KZ
Auschwitz ein. Die Frauen wurden im geschlossenen Einsatz in zwei Schichten, 12
Stunden pro Schicht, zur Arbeit gezwungen. Arbeitskleidung, Decken, Essgeschirr sowie
Essen waren durch die Astra-Werke AG zu stellen. Die Häftlinge erhielten keinen
Lohn, aber die Astra-Werke AG musste ein Entgelt von 4,-RM für das Tagwerk unter
Abzug der Verpflegung von 0,70 RM pro Häftling an das KZ Flossenbürg abführen. Die
Unterbringung erfolgte im 5. Stock des Werkes I auf dreistöckigen Holzpritschen, mit
Strohsäcken ohne Bettzeug. Minderwertige Essensrationen, schlechte hygienische Bedingungen,
Kälte und Bestrafungen durch die SS-Wachmannschaften gehörten zum Alltag der Häftlinge. Strafen bestanden u. a. aus Schlägen bzw. Essensentzug, meist wegen mangelnder Arbeitsleistung.
Nach dem Bombenangriff auf Chemnitz am 5. März 1945 gab es für einige Tage kein
Essen, Hunger, Kälte und Krankheiten, auch Tote durch Unterernährung, waren die
Folgen der menschenunwürdigen Verhältnisse. Es gab nachgewiesen zwei Tote, drei
Frauen flüchteten und acht wurden ins KZ Ravensbrück.
Als Wachpersonal kamen etwa 40, meist junge weibliche Betriebsangehörige von der
Astra-Werke AG zum Einsatz, die für diese Zeit der SS unterstellt waren. Nur wenige
Frauen meldeten sich freiwillig, viele Frauren wurden unter Androhung von Strafen
durch die Betriebsleitung gezwungen, Mitte August 1944 an einem „Lehrgang“ im KZ
Ravensbrück teilzunehmen. Die Ausbildung dauerte nur wenige Tage. Von dort wurde
ein Teil als SS-Aufseherinnen in das KZ-Außenlager von Buchenwald, nach Leipzig-Schönau,
und ein anderer Teil in das im Aufbau befindliche Außenlager des KZ Flossenbürg, zur
"Freia" nach Freiberg, abkommandiert. Erst Ende 1944 bzw. Anfang 1945 kamen die
meisten Frauen als SS-Aufseherinnen wieder bei der Astra-Werke AG zum Einsatz.
In der Nacht vom 12. zum 13. April marschierten die Häftlinge unter strenger Bewachung
durch Chemnitz zum Güterbahnhof Hilbersdorf. Am 14. April 1945 fuhren sie
in zehn vollkommen verschlossenen Güterwagen nach Leitmeritz (Litomerice). Sie standen
in diesem Güterzug einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem Güterbahnhof
Hilbersdorf. Es gab weder Sitzgelegenheiten noch Stroh. Sie waren so eng eingepfercht,
dass sie sich während der ganzen Fahrt nicht legen konnten. Von Leitmeritz (Litomerice)
marschierten sie zu Fuß nach Hertine, wo sie bis zur Befreiung in einer Munitionsfabrik
arbeiten mussten. Es kam in dieser Munitionsfabrik bei den Frauen zu Vergiftungen,
teilweise mit tödlichem Ausgang. Die Anzahl der Toten ist aus den Zeugenberichten
nicht ermittelbar.
NS-Terror und Verfolgung in Sachsen
Dr. Hans Brenner und seine 50 Mitstreiter haben ein umfangreiches Werk über die Anfänge der Konzentrationslager in Sachsen vorgelegt.
Die Neuerscheinung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wirft ein neues Licht auf die Zeit der Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 in Sachsen. Zu den Themen zählen das System der Frühen Konzentrationslager von 1933 bis 1937 (mit mindestens 80 sächsischen Städten und Gemeinden), die politischen Prozesse gegen Gegner des NS-Systems, Opferschicksale aus den verschiedenen Verfolgten-Gruppen und die als Todesmärsche bezeichneten Evakuierungsmärsche aus Konzentrationslagern und deren Außenlagern ab Herbst/Winter 1944 über sächsisches Territorium.
Mit einem umfangreichen Datenanhang und vier thematischen Karten liefert das Buch neuestes Forschungsmaterial für die sächsische Heimat- und Landesgeschichte.
Brenner, Hans / Heidrich, Wolfgang / Müller, KlausDieter / Wendler, Dietmar (Hrsg.) NS-Terror und Verfolgung in Sachsen.
Von den Frühen Konzentrationslagern bis zu den Todesmärschen Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Dresden 2018, 624 S
Von Leipzig über Waldheim nach Buchenwald vom Anarchosyndikalisten zum Kommunisten
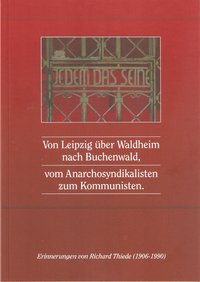
Erinnerungnen von Richard Thiede (1906 - 1990) Herausgegeben von Gert Thiede
Zu diesem Bericht Im Januar 1984, mit bereits 78 Jahren, hat mein Vater versucht, sein persönliches Leben schriftlich festzuhalten.
Sein Ziel war es, die Erinnerungen einmal in einer Schrift zusammenzufassen und der Öffentlichkeit oder einem Museum zur Verfügung zu stellen. Dabei kam es ihm vor allem darauf an, die in Zeiten politischer Engstirnigkeit mancher Funktionäre, ihre abwertende und abweisende Einschätzung zum Wirken der Freien-Arbeiterunion-Deutschlands (FAUD) in der Betrachtung der Arbeiterbewegung richtig zu stellen. ....