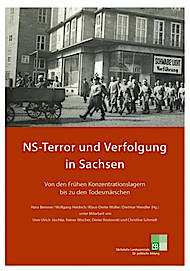- Aktuelles
- Wir
- Spurensuche
- Zeitzeugen
- Gedenktage - Zur Erinnerung und Mahnung
- Lidice
- Gedenk- und Bildgungsstätte Kassberg
- Unvergessen - Eine Rubrik zur Erinnerung und Mahnung
- Kriegsspuren in Chemnitz
- Stolpersteine - Mahnen auch in Chemnitz
- Ausstellungen, die die VVN BdA Chemnitz begleitet hat
- Kriegsendphasenverbrechen der Nazis - Eine Periode die nicht vergessen werden soll
- Stadtrundgang - "Auf den Spuren des antifaschistischen Widerstands in und um Chemnitz"
- Sachsenburg
- Friedhöfe
- Straßenumbenennungen - Erfassung aller nach 1990 erfolgten Umbennenungen von Straßen, Plätzen und Gebäuden in Chemnitz und Umgebung
- Kontakt
- Impressum
Folgen Sie uns:
Suche
Suche
Für ihn gab es keine Helden
Ein Kalenderblatt für Erich Knorr (*24. Oktober 1912)


Mit der Bezeichnung Held konnte der gebürtige Claußnitzer wohl nie etwas anfangen, schon gar nicht als sein Land die DDR, diesen Begriff auf ihn selbst anwandte. Helden des antifaschistischen Widerstandskämpfers gab es zwar auch für Erich Knorr, doch mit einer ziemlich definierten Eigenschaft, sie waren tot, hatten das wertvollste gegeben, ihr Leben - in den meisten Fällen wurde es ihnen genommen, und der Kommunist Erich Knorr musste es mit ansehen, wenn die Schergen ihre Opfer zur Hinrichtung zum Schießstand auf den Heuberg brachten.
Zu dieser Zeit befand er sich im Strafbataillon 999, als Häftling aus dem Zuchthaus Waldheim entlassen. Ein bewegtes politisches Leben lag bereits hinter dem gelernten Schlosser. Schon mit fünfzehn Jahren war er organisiert, Luxemburgianer, Sozialistische Arbeiterjugend, SPD und schließlich der öffentliche Übertritt zum Kommunistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD). Neben der Politik war für ihn, der aus einfachen Verhältnissen stammte, Bildung, die den einfachen “Proleten” verwehrt blieb, ein erstrebenswertes Ziel. Er besuchte die Schaller-Schule in Leipzig, Esperanto-Lehrgänge und schloss sich mit Freunden in einer alternativen Wohnform, der Kommune “Bolschewo” in der Herrenheide zusammen.
Einer der Genossen von damals war sein enger Freund Albert Hößler, der auch zu den wahren Helden gehörte, die Erich Knorr schätzte. Ihre Ansichten ähnelten sich sehr und gemeinsam glühten sie für die Ideale der Kommunistischen Bewegung, doch nicht mit Scheuklappen, organisierten gemeinsame antifaschistische Aktionen mit Sozialdemokraten. 1933 war der Angehörig des RFB bereit, die Weimarer Republik mit der Waffe zu verteidigen. Doch daraus wurde nichts, es gab keinen Befehl und kein Losschlagen. So blieb die illegale Arbeit, Kurierdienst in die CSR, Untertauchen im freiwilligen Reichsarbeitsdienst und der Aufbau von Widerstandsgruppen. Emigration kam vorerst nicht in Frage, später fehlte die Gelegenheit. “Kämpfen wo das Leben ist”, dieser Satz von Clara Zetkin, die er verehrte und zu deren Gedenken er viele Jahe später, als Rentner, eine Gedenkstätte in ihrem Geburtsort Wiederau iniitierte, blieb bis zum Schluß die Leitlinie seines Handelns. Als politischer Leiter des illegalen KP Bezirks Burgstädt-Rochlitz. Nach erfolgreichem Neuaufbau einer illegalen Parteistruktur in Chemnitz wurde er schließlich 1935 verhaftet und kam über Zwickau-Osterstein in das Zuchthaus Waldheim. Die Debatten unter den Gefangenen zum Hitler-Stalin-Pakt brachte ihn in eine gewisse Isolation, denn er teilte die positive Auslegung der führenden Genossen nicht. Nach Jahren im Kerker startete er in Absprache mit engen Freunden in der Haft und der Familie einen Entlassungsversuch, der nur über ein Gnadengesuch auf den Weg gebracht werden konnte.
Der Schritt in die Freiheit schien jedoch verwehrt zu bleiben, da eine Zusammenarbeit mit der Gestapo nicht in Frage kam. Um so überraschender erfolgte die Entlassung , wenig später die Einberufung zum Strafbataillon. Auch dort wieder illegale Arbeit mit dem Ziel des Überlaufens zum “Feind”. Doch die Gelegenheit bot sich nicht. Dafür gab es eine Begegnung, die neue Perspektiven eröffnete. In Griechenland traf er mit dem Sozialdemokraten Karl König zusammen. Dieser hatte in Berlin Kontakt zu Julius Leber und Kreis Stauffenberg. Der Schütze Knorr hörte im Frühjahr 1944 von den Plänen eines Attentats auf Adolf Hitler und von der Idee, aus dem Kreis der 999er eine loyale Truppe zum Schutz der neuen Regierung nach Berlin zu entsenden. Die Geschichte verlief anders, nur der Entschluss, den er gemeinsam mit König gefasst hatte, am letzten Tag des Krieges frei in der Heimat zu sein, blieb. Dies gelang.
Schon im Mai 1945 wurde er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, kurz darauf Landrat von Rochlitz. Der Kampf war nun gegen den Hunger zu führen. Er wurde ein Mann der Landwirtschaft. Leiter des Referats Landwirtschaft. Kulturleiter des MAS-Landesverwaltung Sachsen, Betriebsleiter der Saatzuchtbetriebe in Quedlinburg und ab Juli 1950 stellvertretender Generalsekretär der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, verantwortlich als Leiter der Westabteilung und organisatorisch an der Konstituierung des gesamtdeutschen Arbeitskreises für Land- und Forstwirtschaft maßgeblich beteiligt. Nach dem ein Anwerbeversuch des MfS zur Überwachung von Kurt Vieweg misslang, geriet er selbst in das Visier der Staatssicherheit.
Trotz Beurlaubung von seinen Funktionen gehörte er im Mai 1952 einer Delegation unter Walter Ulbricht zum Studium der Erfahrungen bei der Bildung von Produktionsgenossenschaften in Ungarn an. Er wurde Nachfolger von Vieweg als Generalsekretär und 1. Sekretär des Zentralvorstandes der VdgB. Im Juni 1957 erneut beurlaubt, wurde er schließlich wegen “revisionistischer” Auffassungen abgesetzt. Er ging seinem alten Ziel nach und setzte seinen Bildungsweg fort, wurde Dipl. Agronom. Politisch blieb er unangepasst. In Mecklenburg, fern der Heimat, geht die Gründung des Ortes Neu-Rochlitz auf ihn zurück, dort war er bis zu seiner Ablösung, wegen “Liberalismus in der Leitungstätigkeit”, Vorsitzender des Kreises Güstrow. Seine berufliche und politische Karriere in der DDR endete als Lehrer an den Bezirksparteischulen von Güstrow und Mittweida.
Seine Vergangenheit holte ihn mehrfach ein und war mitverantwortlich für jähe Wendungen, mehr als einmal war aufgefordert sich zu rechtfertigen. Auf der Parteihochschule 1948 gehörte Wolfgang Leonhard zu seinen Dozenten, er war mit Menschen bekannt, bereits aus der Zeit vor 1933, deren Schicksal ebensolchen Wendungen unterworfen waren. Zu diesen gehörte auf Walter Janka, mit dem er später im Rat der Alten bei der PDS wieder zusammentreffen sollte. Der politisch Umbruch bedeutete für Erich Knorr keinen politischen Neuanfang, jedoch auch Umdenken und Kräfte sammmeln, um aktiv zu bleiben als Sozialist. Die Basis delegierte in zum Sonderparteitag der SED.
Er fühlte sich weiterhin seinen Idealen verpflichtet, rang um die Ehre des Helden des antifaschistischen Widerstandes und setzte sich für den Wiederaufbau der KZ Gedenkstätte Sachsenburg ein. Er publizierte und veröffentlichte zu Fragen der Bodenreform und Umgestaltung der Landwirtschaft. Der Entwicklung Chinas galt sein Interesse. Wenige Tage vor seinem Tod, am 23. September 2012, vollendete er einen Artikel, in dem er sich intensiv mit der Frage des Verrats und internen Zerwürfnissen während des antifachistischen Widerstandskampfes 1933 befasste.
Publikationen : u.a. “Große Tage des kleinen Bauern” - 1956, “Wenn schon eine LPG, dann de beste Kreises” in “Wie wir angefangen haben” - 1985, “Dokumente und Erinnerungen - KZ Sachsenburg” - 1994,
Quelle: Neues Deutschland, Enrico Hilbert
NS-Terror und Verfolgung in Sachsen
Dr. Hans Brenner und seine 50 Mitstreiter haben ein umfangreiches Werk über die Anfänge der Konzentrationslager in Sachsen vorgelegt.
Die Neuerscheinung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wirft ein neues Licht auf die Zeit der Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 in Sachsen. Zu den Themen zählen das System der Frühen Konzentrationslager von 1933 bis 1937 (mit mindestens 80 sächsischen Städten und Gemeinden), die politischen Prozesse gegen Gegner des NS-Systems, Opferschicksale aus den verschiedenen Verfolgten-Gruppen und die als Todesmärsche bezeichneten Evakuierungsmärsche aus Konzentrationslagern und deren Außenlagern ab Herbst/Winter 1944 über sächsisches Territorium.
Mit einem umfangreichen Datenanhang und vier thematischen Karten liefert das Buch neuestes Forschungsmaterial für die sächsische Heimat- und Landesgeschichte.
Brenner, Hans / Heidrich, Wolfgang / Müller, KlausDieter / Wendler, Dietmar (Hrsg.) NS-Terror und Verfolgung in Sachsen.
Von den Frühen Konzentrationslagern bis zu den Todesmärschen Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Dresden 2018, 624 S