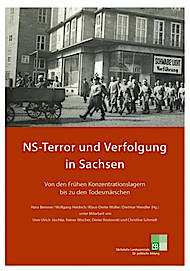- Aktuelles
- Wir
- Spurensuche
- Zeitzeugen
- Gedenktage - Zur Erinnerung und Mahnung
- Lidice
- Gedenk- und Bildgungsstätte Kassberg
- Unvergessen - Eine Rubrik zur Erinnerung und Mahnung
- Kriegsspuren in Chemnitz
- Stolpersteine - Mahnen auch in Chemnitz
- Ausstellungen, die die VVN BdA Chemnitz begleitet hat
- Kriegsendphasenverbrechen der Nazis - Eine Periode die nicht vergessen werden soll
- Stadtrundgang - "Auf den Spuren des antifaschistischen Widerstands in und um Chemnitz"
- Sachsenburg
- Friedhöfe
- Straßenumbenennungen - Erfassung aller nach 1990 erfolgten Umbennenungen von Straßen, Plätzen und Gebäuden in Chemnitz und Umgebung
- Kontakt
- Impressum
Folgen Sie uns:
Suche
Suche
Dr. Ernst Hadermann

Ernst Hadermann wurde am 22. Mai 1896 in Schlüchtern(Hessen-Nassau) geboren und verstarb am 2. Januar 1968 in Halle(Saale).
Er, Sohn eines Mühlenbesitzers, besuchte von 1902 bis 1911 die Volks- und Lateinschule in Schlüchtern und machte 1914 das Abitur. Danach meldete er sich mit Beginn des 1. Weltkrieges freiwillig und wurde mehrfach verwundet. Nach dem Waffenstillstand und seiner Entlassung als Leutnant wurde er in den Arbeiter- und Soldatenrat der Garnison Fulda gewählt. Während des Studiums der Germanistik und der Geschichte an mehreren Universitäten betätigte er sich politisch und unterstützte sozialrevolutionäre Strömungen. 1923 promovierte er zum Dr. phil.
Ab 1939 leistete Hadermann Kriegsdienst und wurde mit der Spange zum EK I ausgezeichnet. Am 18. Juli 1941 geriet er als Hauptmann bei Rogatschew(Dnepr) in sowjetische Gefangenschaft. In Jelabuga an der Kama, im Kriegsgefangenenlager für deutsche Offiziere, konnte Hadermann eine kleine Bibliothek nutzen und eine Rede ausarbeiten, die Aufsehen erregen sollte und trug sie am 21. Mai 1942 Mitgefangenen vor. Gemeinsam mit Walter Ulbricht wurde Hadermann zur Lautsprecherpropaganda an der Front eingesetzt.
Hadermann zählte sich zu den Stillen im Lande, zu jenen, die meinten, zu einer Minimalloyalität verpflichtet zu sein, zu jenen, die hofften, einfach durch ihr Vorhandensein den Ungeist niederhalten zu können. Ein Denkfehler, den Hadermann offenbar zum Teil nach der Reichpogromnacht 1938, aber in seiner Totalität erst in der Kriegsgefangenschaft 1942 erkannte. Von den Nationalsozialisten wurde Hadermann im Dezember 1944 formell „aus dem Wehrdienst entlassen“, um ein Verfahren vor dem "Volksgerichtshof" einzuleiten. Dieses Verfahren war bei Kriegsende noch anhängig.
Im Kriegsgefangenenlager Jelabuga bildete sich die erste antifaschistische Offiziersgruppe unter Hauptmann Ernst Hadermann. Er war später Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses des NKFD, Mitarbeiter der Zeitung Freies Deutschland und Mitglied der erweiterten Redaktion des Senders "Freies Deutschland". Er war auch Gründungsmitglied des Bundes Deutscher Offiziere(BDO) ebenso wie der Berliner Gymnasiallehrer und Offizier Fritz Rücker, mit dem er nach dessen Gefangennahme im Dezember 1942 gezielt zur Mitarbeit zusammengeführt wurde. 1943 wirkte Hadermann im Kessel von Stalingrad auch bei Lautsprechereinsätzen mit. Er war Verfasser und Sprecher zahlreicher politischer Wochenbetrachtungen und Kultursendungen beim Radiosender Freies Deutschland.
Das Engagement Hadermanns im Nationalkomitee „Freies Deutschland“ setzte sich nach dem Krieg übergangslos in seinem Einsatz für ein besseres Deutschland fort. Anfang Februar 1945 war er Mitautor der „Auswahl und Deutung des Deutschen Schrifttums in der höheren Schule (Oberklassen)“, Ende Juli 1945 (formell immer noch Kriegsgefangener) war er Mitautor der „Richtlinien für den Unterricht in deutscher Geschichte“. Von August 1945 an leitete er drei Jahre lang die Schulabteilung der "Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung" in Berlin (die ersten anderthalb Jahre als stellvertretender Leiter) und arbeitete dabei u. a mit Erwin Marquardt, Paul Oestreich und Heinrich Deiters zusammen. Von 1948 bis 1949 war er für den Kulturbund Mitglied des I. Deutschen Volksrats. Von 1948 bis 1950 war er Mitglied der SED. 1950 sondierte er die Möglichkeiten einer Rückkehr in seine hessische Heimat, an der er zeit seines Lebens hing. Der Preis erschien ihm jedoch inakzeptabel hoch zu sein; sein Engagement in Moskau machte ihn im Westen zu einer „Persona non grata“, und auch von seinen westdeutschen Familienangehörigen erhielt er ausdrücklich keine Hilfe. Alle Beziehungen zur Verwandtschaft in Westdeutschland wurden abgebrochen. Diesen Verlust seiner Heimat hat er bis ans Lebensende nicht mehr verwunden. Hadermann wollte Schuld abtragen, meinte, seine Fehler wiedergutmachen zu müssen, und er engagierte sich mit der ihm gegebenen Lauterkeit und Redlichkeit in der Bildungspolitik der jungen DDR.
Hadermann war von 1950 bis 1955 Prodekan der Allgemeinwissenschaftlichen Fakultät der Brandenburgischen Landeshochschule (seit 1951 Pädagogische Hochschule Potsdam) und von 1955 bis zu seiner Emeritierung 1962 Direktor des Instituts für Germanistik an derMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle(Saale). Die Universität Halle blieb bis zu seinem Tod sein Wissenschafts- und Lebensmittelpunkt.
Ehrungen
1956 Ernst-Moritz-Arndt-Medaille; 1958 Medaille für Kämpfer gegen den Faschismus.
Anlässlich seines 65. Geburtstages wurde Hadermann im Juni 1961 mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber ausgezeichnet. 1965 erhielt er den Vaterländischen Verdienstorden in Gold.
Quellen/Literatur
Prof. Dr. Ernst Hadermann – ein deutscher Humanist. Zu seinem 100. Geburtstag. Potsdam 1996.Dieter Kirchhöfer, Christa Uhlig (Hrsg.)
Finker, K.: Prof. Dr. E. H. – Ein dt. Humanist. Fs. Potsdam 1996
Ernst Hadermann. Bildungsdenken zwischen Tradition und Neubeginn. Peter Lang, Frankfurt am Main 2008
Ernst Hadermann, ein guter Deutscher. Zum 25. Jahrestag der Gründung des Nationalkomitees „Freies Deutschland“. 12./13. Juli 1968. Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Offiziere. Eine Mahnung an das westdt. Bürgertum. Berlin 1968
Ernst Hadermanns Rolle im Nationalkomitee „Freies Deutschland“. In: Militärgeschichte 27 (1988), S. 57 ff
Orte des Gedenkens
NS-Terror und Verfolgung in Sachsen
Dr. Hans Brenner und seine 50 Mitstreiter haben ein umfangreiches Werk über die Anfänge der Konzentrationslager in Sachsen vorgelegt.
Die Neuerscheinung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wirft ein neues Licht auf die Zeit der Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 in Sachsen. Zu den Themen zählen das System der Frühen Konzentrationslager von 1933 bis 1937 (mit mindestens 80 sächsischen Städten und Gemeinden), die politischen Prozesse gegen Gegner des NS-Systems, Opferschicksale aus den verschiedenen Verfolgten-Gruppen und die als Todesmärsche bezeichneten Evakuierungsmärsche aus Konzentrationslagern und deren Außenlagern ab Herbst/Winter 1944 über sächsisches Territorium.
Mit einem umfangreichen Datenanhang und vier thematischen Karten liefert das Buch neuestes Forschungsmaterial für die sächsische Heimat- und Landesgeschichte.
Brenner, Hans / Heidrich, Wolfgang / Müller, KlausDieter / Wendler, Dietmar (Hrsg.) NS-Terror und Verfolgung in Sachsen.
Von den Frühen Konzentrationslagern bis zu den Todesmärschen Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Dresden 2018, 624 S
© 2025 VVN-BdA-Chemnitz